Als Vermieter von Monteurzimmern oder Ferienwohnungen können Sie im Einzelfall Gründe haben, eine bereits bestätigte Buchung wieder stornieren zu wollen. Dies könnte beispielsweise passieren, wenn sich eine größere Gruppe angesagt hat, für deren Unterbringung Sie eigentlich den gesamten Platz benötigen würden.
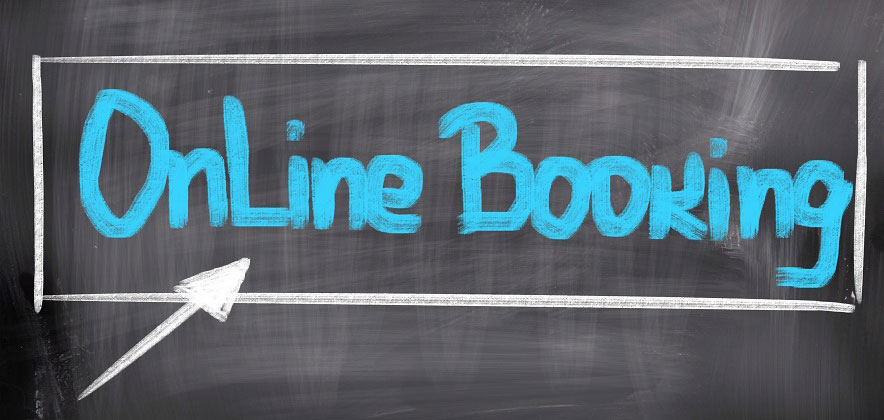
In der Vor- oder Nachsaison könnte es auch vorkommen, dass Sie sich spontan entschließen, den Betrieb
ganz einzustellen, um notwendige Renovierungsarbeiten vor Beginn der neuen Saison durchzuführen.
Warum auch immer ein Storno wirtschaftlich vorteilhafter für Sie sein sollte: Wir empfehlen Ihnen, an
der einmal bestätigten Reservierung
festzuhalten, denn der Gast hat ein gesetzliches Anrecht auf die Bereitstellung der ihm zugesagten
Leistungen.
Trotzdem gibt es Möglichkeiten, einen einmal geschlossenen Beherbergungsvertrag im gegenseitigen
Einvernehmen wieder aufzulösen. Im Folgenden haben wir einige Tipps zum Thema für Sie zusammengestellt.
Inserieren Sie Ihre Ferienwohnung provisionsfrei auf Deutschland-Monteurzimmer.de.
Volle Kostenkontrolle. Hohe Auslastung, auch in der Nebensaison.
Die Rechtslage
Hat ein Mieter eine Unterkunft bestellt und dafür bereits eine Bestätigung von Ihnen bekommen, haben
beide Parteien damit einen rechtsgültigen Beherbergungsvertrag abgeschlossen.
Dies bedeutet, dass beide Seiten einander zur Leistung verpflichtet sind. Rein rechtlich gibt es keine
Möglichkeit, solch einen Vertrag einseitig aufzulösen, ohne sich dafür schadenersatzpflichtig zu machen.
Für Sie als Vermieter hat dies den Vorteil, dass der Gast Ihnen auch dann zur Zahlung verpflichtet ist, wenn er Ihre Leistungen nicht in Anspruch nimmt.
Umgekehrt bedeutet es, dass Sie dem Mieter gegenüber schadenersatzpflichtig werden, falls Sie die von ihm gebuchte Unterkunft nicht termingerecht zur Verfügung stellen. Ist er deshalb gezwungen, auf ein teureres Quartier auszuweichen, könnte er von Ihnen die Erstattung des Differenzbetrags verlangen.
Hierbei ist es unerheblich, wie viel Zeit zwischen der Stornierung und dem Beginn der Vertragslaufzeit liegt. Die einzigen Ausnahmen von dieser Regelung bestehen in den Fällen der sogenannten höheren Gewalt (Erdbeben, Blitzschlag, Kriegsausbruch), Ereignissen also, die sich Ihrem Einfluss entziehen.
Vertragsauflösung in gegenseitigem Einvernehmen
Die strengen gesetzlichen Regelungen über die grundsätzliche Gültigkeit von Verträgen dienen dem Zweck der Herstellung von Rechtssicherheit. Jeder sollte sich grundsätzlich darauf verlassen können, dass einmal abgeschlossene vertragliche Vereinbarungen auch eingehalten werden.

Dies bedeutet nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt, vorzeitig aus einem Vertrag auszusteigen. An dieser Stelle kommt das gegenseitige Einvernehmen ins Spiel, was bedeutet: Wenn Sie möchten, dass der Mieter Sie aus dem Vertrag entlässt, müssen Sie geschickt mit ihm verhandeln.
Hierzu empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
- Kontaktieren Sie Ihren Vertragspartner am besten per E-Mail und schildern Sie ihm die Gründe, weshalb Sie gerne vom Vertrag zurücktreten würden.
- Bitten Sie um sein Verständnis und betonen Sie, dass Sie sich selbstverständlich an den Vertrag gebunden fühlen, falls er auf dessen Einhaltung bestehen sollte.
- Schlagen Sie ihm Alternativen vor. Dies könnte das Angebot sein, sich um die Beschaffung einer gleichwertigen Unterkunft in ähnlicher Lage zu kümmern und den Kontakt zu vermitteln.
- Falls Sie erhebliche wirtschaftliche Vorteile aus einer Vertragsauflösung zu erwarten haben, könnten Sie dem Mieter eine Wiedergutmachung in Geldform anbieten.
- Entschuldigen Sie sich vorab bei ihm für eventuelle Unannehmlichkeiten und betonen Sie, wie sehr er Ihnen durch eine kulante Haltung helfen würde.
Die meisten Menschen reagieren erfahrungsgemäß positiv auf eine freundliche Bitte und sind bereit, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihnen kein großer Nachteil daraus erwächst. Verzichten sollten Sie hingegen auf jede Art von Ausreden oder Tricks, da Ihnen diese bestenfalls negative Bewertungen im Internet, schlimmstenfalls aber eine Anzeige wegen Vertragsbruchs einbringen könnten.
Unterkunft erfolgreich im Internet an Berufsreisende und Feriengäste vermieten.
* Entspricht den durchschnittlichen Kosten einer Unterkunft pro Woche bei voller Belegung.pro Woche *
Musteranschreiben zur Stornierung
Folgenden Text können Sie als Vorlage für ein Mailanschreiben an den Gast verwenden:
Sehr geehrte(r) Herr/Frau […],
am [Datum] haben Sie einen Beherbergungsvertrag für den Zeitraum vom [Datum Anreisetag] bis zum [Datum Abreisetag] mit unserem Hause abgeschlossen. Obwohl diese Vereinbarung selbstverständlich gültig und rechtsverbindlich ist, erlauben wir uns, mit der Bitte um eine Vertragsauflösung im gegenseitigen Einvernehmen an Sie heranzutreten. Der Grund ist: [Begründung einfügen]. Wir wären Ihnen deshalb sehr dankbar, wenn Sie uns aus den Verpflichtungen dieses Vertrages entlassen würden.
Selbstverständlich würden wir Sie in diesem Fall nicht auf der Straße stehen lassen: Gerne kümmern wir uns darum, eine gleichwertige Unterkunft für Sie zu besorgen und den Kontakt zwischen Ihnen und dem Vermieter herzustellen. Als kleine Anerkennung für Ihre Bereitschaft bieten wir Ihnen außerdem einen einmaligen Betrag von [50 € oder andere Summe einfügen] als Wiedergutmachung an. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten und lassen Sie uns wissen, ob Sie mit unserem Angebot einverstanden sind.
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen
[Name]
Wenn der Vertragspartner nicht zustimmt
Natürlich kann es vorkommen, dass der Mieter trotz Ihrer gegenteiligen Bitte auf der Einhaltung des
Vertrags besteht.
Sei es, dass alle denkbaren Alternativunterkünfte zu weit von seiner aktuellen Baustelle entfernt liegen
oder er aus Prinzip an der Vereinbarung festhält: Er ist gesetzlich nicht verpflichtet, Ihnen Gründe für
seine Weigerung zu nennen.

In diesem Fall sollten Sie nicht weiter intervenieren und den Vertrag auch dann ohne Einschränkungen
erfüllen, wenn dies zunächst wirtschaftliche Nachteile für Sie bedeutet. Geben Sie dem Gast trotzdem
nicht das Gefühl, dass er Ihnen ungelegen kommt.
Auf lange Sicht werden Sie von dieser Zuverlässigkeit profitieren, da Sie sich so den Ruf eines treuen
Vertragspartners erarbeiten, mit dem jeder gerne regelmäßig ins Geschäft kommt.
Hohe Auslastung, auch in der Nebensaison
Volle Kostenkontrolle
Kundenkonto registrieren und Eintrag anlegen.
Buchung wurde durch Gast storniert - Was tun?
Monteurzimmer und Ferienwohnungen erfreuen sich einer starken Beliebtheit. Hier finden Mieter in ihnen eine preiswerte Unterkunft für wenige Tage. Doch es stellt sich die Frage, wie Sie bei rechtlichen Problemen verfahren. Etwa dann, wenn eine gebuchte Übernachtung nicht zustande kommt.

Dürfen Sie als Vermieter dennoch eine Miete durch den Betroffenen verlangen? Die kurze
Antwort: Ja, Sie sind zu dieser Forderung berechtigt.
Beachten Sie aber, dass unterschiedliche Vertragstypen auch einen unterschiedlichen Umgang mit Stornierungen
beinhalten. Das ist vor allem wichtig, wenn der Buchende keinen Ersatz leisten oder zumindest seine
Ausgaben senken möchte.
Ein Blick in den Beherbergungsvertrag
Normalerweise regeln Sie Buchungen Ihrer Monteurzimmer oder Ferienwohnungen über den Beherbergungsvertrag.
Dieser ist im Bürgerlichen Gesetzbuch nicht ausdrücklich geregelt – seine Anforderungen
bemessen sich an einer Mischung aus unterschiedlichen Vertragstypen. Und diese besagen, dass
geschlossene Verträge einzuhalten sind.
Wer das nicht möchte, setzt sich Schadensersatzforderungen
aus. Denn mit der Annahme des Vertrages und der Bereitstellung der Räumlichkeiten ist es Ihnen als
Vermieter verwehrt, andere Gäste aufzunehmen.
Sie erleiden einen finanziellen Schaden, der Ihnen zumindest anteilig durch den Buchenden zu ersetzen
ist.

Der Beherbergungsvertrag kennt eine Stornierung zunächst nicht. Das ist wichtig, weil er im
Gegensatz zum Reisevertrag somit nicht aus privaten oder beruflichen Gründen beendet werden
kann.
Beide Vertragsparteien sind gezwungen, zu einer einvernehmlichen Auflösung der Abmachung zu kommen,
sofern an dieser nicht mehr festgehalten werden kann.
Ist es dem Mieter durch höhere Gewalt oder Unglücksfälle in der Familie unmöglich,
das Monteurzimmer zu beziehen, dürfen Sie ihn dennoch zur Zahlung der Miete heranziehen. Dazu genügt,
dass die Räumlichkeiten rechtsverbindlich reserviert wurden, weil zumindest ein bindender
Vorvertrag entsteht.
In den letzten Jahren ist beim Vermieten
der Monteurzimmer aber ein neuer Trend zu erkennen. Immer häufiger bieten die Eigentümer
der Immobilie hierbei keinen reinen Beherbergungsvertrag an. Vielmehr wird ein umfangreicher Service
ebenso wie eine Bereitstellung der Reise- und Transportmittel gewährleistet.
Hier stellt sich die Frage, ob sich der Mieter damit nicht augenscheinlich eher dem Reisevertrag
unterwirft. Ein juristisches Problem, das
mit Blick auf mögliche Rechtsansprüche zuletzt vermehrt von deutschen Gerichten zu klären
war.
Prüfen Sie vor Vertragsschluss, ob Sie einen Beherbergungs- oder Reisevertrag benötigen
– und welche gesetzlichen Konsequenzen sich daraus ergeben.
Der Reisevertrag gibt Auskunft
Zunächst prüfen Sie, welche Vertragstypen bei der angedachten Vermietung betroffen sind. Im
weiteren Schritt, welche Aussagen diese zu einer ordentlichen Stornierung durch den Betroffenen tätigen.
Besteht die Buchung aus Flug- und Fahrttickets, dem Hotelzimmer, einer Verpflegung vor Ort und der
Teilnahme etwa an geführten Touren, so wären hier nicht zuletzt der Reise-, der Miet-, der
Dienstleistungs- und der Werkvertrag berührt. Dennoch erlangt der Reisevertrag einen Vorrang
– nach seinen Vorgaben bemisst sich, wie Sie im Falle einer Kündigung durch den Reisenden
verfahren.
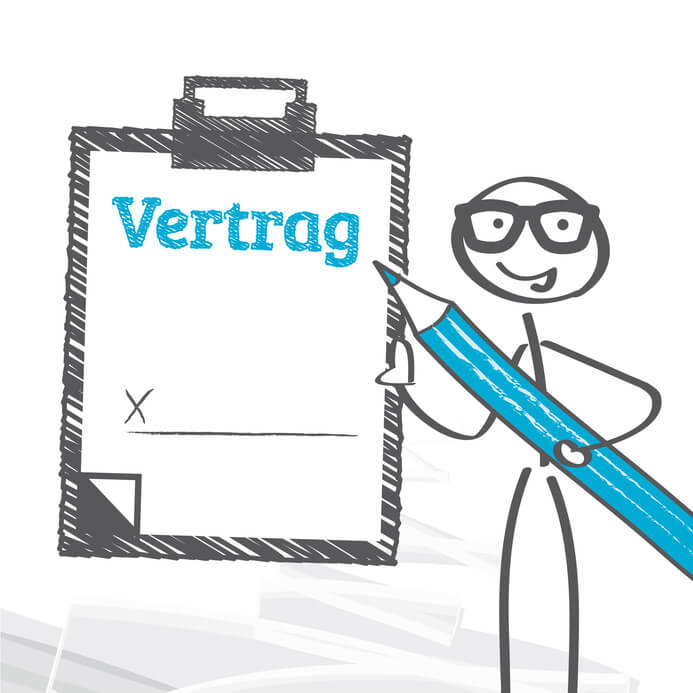
Die Stornierung durch den Reisenden ist in § 651 i des Bürgerlichen
Gesetzbuches geregelt. Und demzufolge darf er sie vornehmen. Eine bestimmte zeitliche Frist für
diesen Schritt wird nicht genannt.
Es ist zunächst unerheblich, ob er die Fahrt fünf Minuten nach der Buchung oder unmittelbar
vor der Abreise kündigt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass auch kurzfristige Gründe
vorliegen können, die Reise nicht anzutreten. Der Gesetzgeber verzichtet bewusst darauf, die Kündigung
in einem zeitlich begrenzten Rahmen zu legitimieren – diese ist jederzeit und selbst nach der
Abfahrt möglich.
Dem gleichen Paragrafen ist zu entnehmen, dass Sie den Reisenden durch seine Stornierung immer zum Ersatz jenes Schadens heranziehen können, den er durch die Kündigung auslöst.
Auch in diesem Punkt erweist sich das Gesetz als rigoros – Ausnahmen werden nicht genannt, die
Schadensersatzpflicht tritt automatisch mit dem Stornieren der Fahrt ein. Auf welche Summen Sie hoffen dürfen,
wird prozentual errechnet. Als entscheidend gilt es, wie viele Tage vor Reisebeginn die Fahrt storniert
wurde.
Gehen Sie von Summen zwischen vier und 50 Prozent des Gesamtwertes aus.
Die Buchung ist noch nicht zugegangen
Grundsätzlich gilt, dass Verträge einzuhalten sind. Zumal dann, wenn sie – wie der
Reisevertrag – nicht über ein Widerrufsrecht verfügen, wie es bei anderen Vertragsarten
gängig zur Anwendung kommt. Wer eine Reise bucht, sollte sich über die Konsequenzen im Klaren
sein.
So einfach der Rücktritt von dieser auch gelingen mag – als Vermieter sind Sie stets
berechtigt, Ihren finanziellen Schaden ersetzt zu bekommen. Gäste die dieses Risiko meiden möchten,
können eine Reiserücktrittsversicherung
abschließen, um die Kosten nicht tragen zu müssen. Eine Möglichkeit, die allen
Parteien gerecht wird.
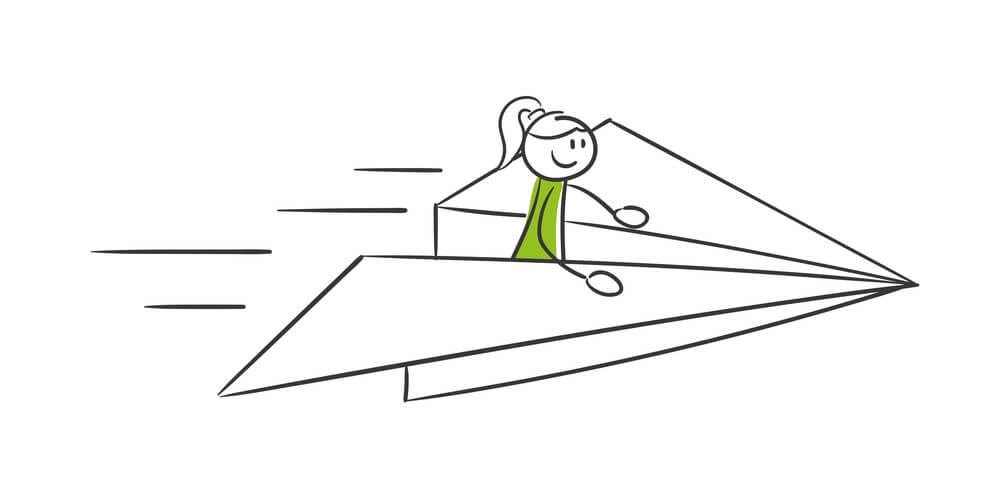
Eine Alternative, sich nicht schadensersatzpflichtig zu verhalten, liegt darin, den Widerruf vor Zugang
des Reisevertrages abzugeben. Mieter, die den Vertrag für das Zimmer unterschrieben per Post an Sie
als Vermieter senden, vor dessen Eintreffen jedoch per Mail oder Telefon verbindlich stornieren, lösen
keinen Schaden aus.
Eine solche Option besteht nur innerhalb der ersten Stunden oder Tage nach einer schriftlichen Buchung
– dennoch ist es damit möglich, eine Reise zu kündigen, ohne sich Ersatzansprüchen
auszusetzen.
Mit einem starken Partner erfolgreich im Internet werben.
